Disclaimer: Dieser Text wurde von einer weißen Person unter Zuhilfenahme von Aufklärungsinhalten Schwarzer Menschen geschrieben – mit dem Ziel, anderen weißen Personen das erlernte Wissen weiterzugeben. Dabei besteht nicht der Anspruch, das Thema vollständig durchdrungen zu haben oder in einer professionellen Form Antirassismus-Expertin zu sein: Ich stecke genauso im Lernprozess wie alle anderen weißen Menschen.
Ist es problematisch, dass ich vor dem Schreiben des ersten eigentlich relevanten Satzes das Bedürfnis habe zu sagen, dass dieses Thema bei uns in der Redaktion schon lange auf Halde liegt, weil ich es vor einiger Zeit gepitcht habe und mich nicht erst seit drei Wochen mit Rassismus beschäftige?
Zackbumm, so schnell waren wir hier noch nie beim Thema. Denn, Spoiler: Natürlich ist es das.
Performativer Aktivismus vs. echter Aktivismus
Mit einer Mischung aus Rührung und Zweifel haben die meisten von uns am 2. Juni auf ihren schwarzen Instagram-Feed geschaut, auf dem sich eine #blackouttuesday-Bekundung an die andere reihte. Das Zeichen der Solidarisierung (ursprünglich von zwei Schwarzen Künstlerinnen aus der Musikindustrie initiiert) von weißen Menschen mit der Black Lives Matter-Bewegung ging so schnell viral, dass die vehemente Kritik, die insbesondere von Schwarzen Aktivist*innen vorgebracht wurde, erst breiteres Gehör fand, als so ziemlich jede*r eine schwarze Grafik mit den entsprechenden Hashtags gepostet hatte.
Diese Kritik hob vor allem hervor, dass wichtige Informationen zu Protesten und Weiterbildung in einem Meer aus schwarzen Kacheln verschwunden waren – weil zunächst überall der Koordinierungshashtag #blacklivematters in den Captions genutzt wurde. Und traf zielsicher den entscheidenden Punkt, um den es bei dieser Form des digitalen Protests ging und der seitdem eine intensive Auseinandersetzung vor allem von Weißen nach sich gezogen hat: War das Posten dieser Kachel jetzt wirklich ein Akt der Solidarität – oder habe ich das gemacht, um mich besser zu fühlen und auf der Seite der „guten Weißen“ zu stehen, mich also vor mir selbst und anderen als moralisch integer zu inszenieren?
Kurzum: Habe ich performativen Aktivismus betrieben?
Ob das bei dieser konkreten Handlung der Fall war oder nicht, lässt sich in der Kürze nicht beantworten (zumindest nicht, ohne weitere Hintergrundinformationen über die jeweilige Person zu besitzen) und wird von BIPoC-Aktivist*innen unterschiedlich interpretiert und bewertet.
Worin sich allerdings alle einig sind: Performativer Aktivismus allein ist viel zu wenig und wird so rein gar nichts an den gesellschaftspolitischen Strukturen, die das Überleben von Rassismus in allen Lebensbereichen und auf unterschiedlichen Ebenen ermöglichen, ändern.
Um herauszufinden, warum das so ist, ist es notwendig, performativen Aktivismus von ernsthaftem Aktivismus abzugrenzen (wir bleiben beim Thema Rassismus, doch die Unterscheidung lässt sich auch auf andere Bereiche anwenden) :
Performativer Aktivismus
Motivation:
Performativer Aktivismus (und das zeigt sich schon am Namen) zeichnet sich durch eine nach außen gerichtete (extrinsische) Motivation aus: Im Fokus steht die Zurschaustellung der eigenen moralischen Integrität für eine Gruppe von Zuschauenden / die Öffentlichkeit.
Funktion:
Positionierung des Individuums als moralisch „auf der richtigen Seite“, Gesichtswahrung, Imagepflege
Merkmale:
- Das Gesagte bleibt an der Oberfläche: wenige Worte, wenig bis kein Eingehen auf die Komplexität von rassistischen Strukturen.
- Äußerung von starken Emotionen (Wut, Ärger, Trauer, Fassungslosigkeit) über das „Unrecht“, das man nicht nachvollziehen könne
- Die Gut-Böse-Dichotomie wird rezitiert: Es gibt ein böses Individuum, das für den Vorfall verantwortlich ist („Einzeltäter*in“), die anderen Menschen (inklusive der sich äußernden Person) sind moralisch integer und „auf der guten Seite“. Der systematische Charakter von Rassismus und die Verantwortlichkeit jeder Einzelperson werden damit geleugnet.
- Durch die Produktion von Allgemeinplätzen, Plattitüden und starken Emotionen werden die Äußerungen meist so aufgenommen wie von der handelnden Person intendiert: mit Lob, Bestätigung, Bestärkung, (virtuellen) Danke-Rufen. Das Feedback bleibt dabei genauso an der Oberfläche wie der ursprüngliche Inhalt.
- Gehandelt wird vor allem punktuell und möglichst wirkungsstark – dann, wenn das Thema gerade en vogue ist und mit viel positiver Resonanz gerechnet werden kann.
- Das Performen birgt für die handelnde Person wenig bis keine Risiken, wohl aber für die marginalisierte Gruppe: Durch uninformierte Unbedarftheit können Retraumatisierungen, zusätzliche emotionale und mentale Arbeit, Frustration und Ärger entstehen – Letztere vor allem auch dann, wenn ein*e weiße Performer*in für eine punktuelle Handlung Anerkennung erhält, für die marginalisierte Menschen seit Jahren/ Jahrhunderten kämpfen
Auswirkungen:
Performativer Aktivismus hilft im besten Falle dem Anliegen der marginalisierten Gruppe nicht weiter, im schlimmsten Fall richtet er mehr Schaden als Nutzen an, in dem er das bestehende rassistische System als „ein Problem der Anderen“ reproduziert und damit die Unterdrückung der marginalisierten Gruppen fortschreibt.
Ernsthafter Aktivismus
Motivation:
Im Idealfall liegt ernsthaftem Aktivismus eine intrinsische Motivation zugrunde: Der ernsthafte Wille, innerhalb des Systems einen bestimmten Umstand zu ändern oder das ganze System umzugestalten. Im Fokus steht nicht die handelnde Person, sondern das langfristig erstrebte Ziel.
Funktion:
Veränderung der gesellschaftspolitischen Realität hin zu einer aus der Perspektive des*der Handelnden besseren, gerechteren und lebenswerteren Zukunft
Merkmale:
- Das Gesagte ist differenziert, versucht, mehrere Standpunkte einzubeziehen und/oder kann auf einer bereits fundierten Meinung aufgrund intensiver Beschäftigung mit der Thematik basieren.
- Die eigene Verantwortlichkeit innerhalb des rassistischen Systems wird genauso anerkannt wie die Privilegien, die als weiße Person vorhanden sind.
- Rassismus wird als System verstanden, das alle Bereiche des Lebens umfasst und in das alle Mitglieder der Gesellschaft hinein sozialisiert werden: Der in der eigenen Person vorhandene Rassismus wird anerkannt, die Gut-Böse-Dichotomie ist (bis auf wenige Ausnahmen) aufgehoben.
- Der aktive und detaillierte Austausch wird gesucht – es wird nicht nur emotional Stellung bezogen, sondern nach Weiterentwicklung und Wissensweitergabe gestrebt.
- Das alles passiert nicht punktuell, sondern kontinuierlich über einen langen Zeitraum.
- Nicht jede Handlung wird als zu feiernder aktivistischer Akt inszeniert: Viel passiert im Verborgenen, ohne die Kalkulation auf Applaus.
- Die Positionierung birgt Risiken: Beschneidung bis Verlust eigener Privilegien, Anfeindungen von weißen Menschen, die sich angegriffen und/oder „verraten“ fühlen, Konsequenzen im Privat- und Berufsleben
Auswirkungen:
Kontinuierliche Weiterbildung der handelnden Person und im Idealfall eine Veränderung der bestehenden gesellschaftspolitischen Verhältnisse.
Beispiele für performativen Aktivismus
- Centering: Der*die Performerin stellt sich selbst in den Mittelpunkt – postet zum Thema Rassismus beispielsweise ein Bild mit sich selbst als weißer Person, oft ästhetisch-instagrammable inszeniert
- Verweigerung eines konstruktiven Dialogs: Kritische Kommentare werden gelöscht, Nutzer*innen blockiert
- Oberflächliche, inspirierende Statements, keine klare Positionierung in einer Situation, in der Rassismus zutage tritt
- Delegieren der Bildungsarbeit an BIPoC: Fragen nach einem bestimmten Konzept/Begriff etc., um Aufmerksamkeit auf das eigene Interesse an der Angelegenheit zu lenken
Beispiele für ernsthaften Aktivismus
- Vor der Handlung nachdenken und informieren: Es geht nicht um die*den weiße Performer*in und ihre*seine Gefühle. Selbst, wenn die Handlung gut gemeint ist, kann sie genau das Gegenteil bewirken.
- Langfristiges Lernen und Weiterbilden im Thema und die aktive Auseinandersetzung mit dem eigenen Weiß-Sein – auch, wenn die mediale Aufmerksamkeit längst verflogen ist
- Das Gelernte praktisch umsetzen: Stimmen von BIPoC nicht als Ausnahme, sondern als Regel betrachten, weiter Informationen und Wissensquellen teilen
- Fehler einkalkulieren (es ist unmöglich, keine zu machen), zugeben, sich entschuldigen und dazulernen
Virtue Signalling: offene, lautstarke Äußerung moralischer Werte, die nicht im Einklang mit den Handlungen der Person stehen, weil sie nicht dazu beitragen, das adressierte Problem aktiv anzugehen
Thoughts and Prayers: Häufig als Kondolenz-Ausdruck gebraucht, mittlerweile jedoch auch als Phrasen-Ersatz für gesellschaftspolitische Veränderung genutzt
Slacktivism: Eine (öffentliche) Angelegenheit vor allem mit der Absicht unterstützen, sich selbst als wirksam, „wach“ und aktiv wahrzunehmen und inszenieren zu können
Performativer Aktivismus ist, wenn man es kritisch zusammenfasst, Selbstbeweihräucherung in der Öffentlichkeit: mit minimalem bis nicht vorhandenem Risiko und Aufwand den maximalen Ertrag an Aufmerksamkeit und Zuspruch „für die gute Sache“ erhalten. Damit steht er in direkter spätkapitalistischer Tradition der Social-Media-Aufmerksamkeitsökonomie – und zeigt sehr gut, wo bei aller Nützlichkeit durch Verbreitung und Demokratisierung von Informationen die Wirkungsgrenze sozialer Medien für gesellschaftspolitische Veränderung erreicht ist.
Vom Ausverkauf gesellschaftspolitischer Bewegungen
Man nennt das auch ab und zu woke-washing und die Ähnlichkeit der Terminologie mit anderen -washings (zum Beispiel green-washing) deutet sehr explizit auf eine Offensichtlichkeit hin: performativer Aktivismus ist natürlich nicht nur ein Problem von Einzelpersonen. Im Gegenteil: Große Konzerne, die bisher vor allem durch besonders ausbeuterische Produktionsbedingungen in Ländern des globalen Südens aufgefallen sind, mischen fleißig mit im Spiel des Seele-Reinwaschens und posten schwarze Kästchen, kramen alte Shootings mit BIPoC-Models wieder hervor, weil das gerade gut kommt (vor allem bei der internetaffinen jungen Zielgruppe) und werfen mit pathetischen Phrasen um sich, #blacklivesmatter.
„The work of anti-racism requires a level of self reflection that I don’t feel is coming from all the people or organisations that now say Black Lives Matter.” – Reni Eddo-Lodge
Besonders in die Kritik geraten sind dabei unter anderem Modekonzerne, die teilweise immer noch nicht für die im Zuge Corona-Pandemie gecancelten Bestellungen in den Textilfabriken gezahlt haben – aber auch Firmen aus sämtlichen anderen Lebensbereichen, beispielsweise der Kosmetik-Industrie und natürlich Giganten wie Spotify, Netflix, Pepsi und Amazon. Deutlichen Widerstand gab es unter anderem gegenüber dem Konzern URBN, der unter anderem Anthropologie, Urban Outfitters und Free People unter sich vereint. Der Kern: rührende Werbeversprechen und bunte Illustrationen mit dem Hashtag #BLM auf Social Media, im Tagesgeschäft gehören Ausbeutung und Diskriminierung von BIPoC hingegen gewissermaßen zur Unternehmens-DNA. Unter neuen Instagram-Posts von Anthropologie teilen (ehemalige) Kund*innen und Angestellte ihre Erfahrungen und machen wiederholt auf Diskriminierung gegen BIPoC aufmerksam. So soll eine herabwürdigende Lohnpolitik gewissermaßen zur DNA des Unternehmens gehören, ebenso wie Code-Worte („Nick“/ „Nicky“) unter den Angestellten, mit deren Hilfe sie sich gegenseitig vor Schwarzen Kund*innen „warnen“ sollten sowie Racial Profiling, um angeblich drohenden Ladendiebstahl zu verhindern.
Dass Schwarze Menschen und der gesellschaftliche Kampf für mehr Diversität und Gerechtigkeit generell kaltblütig ins kapitalistische System integriert werden, weil sich damit gerade gut Geld verdienen lässt und das gleichzeitig genau die Mechanismen reproduziert, gegen die man vorzugehen vorgibt, ist nichts Neues – doch der fadenscheinige Fassaden-Aktionismus wird dann besonders deutlich, wenn viele Menschen hinschauen, den Finger draufhalten und Labels zur Verantwortung ziehen – online (calling out) und offline (Konsumboykott). Genau das passiert gerade – unter anderem auch, weil insbesondere junge Konsumierende ihr Geld bewusster ausgeben und inhaltsleere PR-Statements besser durchschauen lernen.
Hier geht es zur #PayUp-Petition, mit der Mode-Konzerne dazu aufgefordert werden, ihre Bestellungen wie vereinbart zu bezahlen. Auch die #FairByLaw-Petition, mit der ein Lieferkettengesetz innerhalb Deutschlands gefordert wird, braucht nach wie vor jede zusätzliche unterzeichnende Stimme, die sie bekommen kann.
Toxic Positivity oder: White Fragility auf Hochtouren
Was aktuell auch viel passiert, ist Folgendes:
- Weiße Menschen positionieren sich zu Rassismus und #BlackLivesMatter.
- Sie werden auf Fehler und eventuell selbst reproduzierte Rassismen in ihrer Positionierung hingewiesen.
- Sie reagieren:
mit Leugnung, Aggression und Täter*in-Opfer-Umkehr: „So habe ich das nicht gemeint, man traut sich ja gar nicht mehr, den Mund aufzumachen!“
mit Centering: „Also, ich finde nicht, dass das rassistisch ist. Ich meine das lieb und anerkennend.“
mit Silencing: „Können wir nicht einfach akzeptieren, dass es verschiedene Perspektiven auf eine Sache gibt? Kritik an allem führt nur zu Spaltung, was wir brauchen, ist kein Hate, sondern Liebe und Einheit.“
Die unterschiedlichen Antwortformen sind meist nicht klar voneinander zu trennen – häufig greifen zwei oder mehr Mechanismen gleichzeitig oder direkt nacheinander. An sich sind solche Reaktionen normal, wenn man sich noch nicht lange mit Rassismus und seiner strukturellen Natur beschäftigt. Der Punkt ist, dass man dann besser vermutlich nicht sofort ein like-versprechendes Spruchbild oder eine problematische Caption geteilt hätte, um irgendwas zu teilen und im Gespräch zu bleiben (und damit den Algorithmus zu füttern und für Kund*innen attraktiv zu bleiben). Sondern zugehört und gelernt und das eigene Verhalten spätestens dann hinterfragt hätte, als eine Vielzahl der nicht erwarteten kritischen Kommentare aufgetaucht ist.
Zu beobachten ist jedoch, dass es häufig bei den problematischen Aussagen und den dahinterstehenden Gedanken bleibt und Versuche einer konstruktiven Diskussion ignoriert, weggeredet oder im Wortsinn blockiert (Personen werden geblockt, die Kommentarfunktion ausgeschaltet) werden. Die verschiedenen Antwortformen funktionieren als Totschlagargumente, mit denen erneut die weiße Weltsicht durchgeboxt wird – und die martialischen Begriffe verwende ich hier ganz bewusst, denn es handelt sich in allen Fällen um Formen von Gewalt.
Diese münden oft in der seit Jahrhunderten bewährten Strategie des Silencing, die von Personen mit größerer systemischer Macht genutzt wird, um andere Personen zu unterdrücken und zu diskriminieren – zum Schweigen zu bringen, wörtlich übersetzt.
„Silencing tactics are fairly simple. They are methods used to quash dissent. To dismiss or disable the voices of dissent against the privilege induced majority speak. They can include trolling someone, threatening someone, making offensive jokes, using slurs, acting violent or intimidating, demanding or even criticizing anger from a marginalized person, demanding that a marginalized person change their methods for addressing privilege and a host of other things that are design to control the means of communication and discourse.“ – R.P.
Wie Silencing aussehen kann:
- jemanden verbal oder physisch bedrohen
- übergriffige Witze machen (und sich dann mit „War doch nur ein Scherz” aus der Affäre ziehen)
- jemanden beleidigen / rassistische Bemerkungen machen
- gewalttätiges Verhalten an den Tag legen / einschüchtern
- Wut / Ärger von einer marginalisierten Person entweder explizit einfordern („Wenn es wirklich so schlimm wäre, müsstest du doch wütend sein?!”) oder kritisieren / einen „angenehmeren” Umgangston fordern
- Rücksicht auf die eigenen Gefühle und das vermeintliche eigene erlittene Leid fordern (auch: Derailing / Ablenkung)
Der Zweck des Ganzen: Die Kontrolle über die Art der Kommunikation zu behalten – und damit auch darüber, was gesagt wird und was verschwiegen werden muss, weil es bestehende Machtverhältnisse herausfordert.
Vor allem in der Eco-Bubble hat man viel Silencing gelesen und gehört in den letzten Wochen und von dem Fokus auf Liebe und Einheit und Wir-sind-doch-alle-gleich-und-kämpfen-den-gleichen-Kampf. Sorry to destroy your privileged rainbow-dancing-paradise, aber: Das ist nicht der Fall.
Auch dieses Verhalten lässt sich mit einem Begriff zusammenfassen: Toxic Positivity. Vereinfacht gesagt, handelt es sich dabei um die Übergeneralisierung eines glücklichen, optimistischen Zustandes, der in der Leugnung, Abwehr und Kleinhaltung (also: Silencing) authentischer menschlicher emotionaler Erfahrungen mündet. Toxic Positivity ist der ausschließliche Fokus auf ein imaginiertes „Gutes“, das nicht näher definiert wird und kann sowohl auf individueller (man gesteht sich selbst als negativ interpretierte Gefühle nicht zu und unterdrückt sie folglich) als auch auf struktureller Ebene wirken. Die strukturelle Ebene äußert sich dann unter anderem in Silencing – wie gesagt: einer Form von Gewalt. Und damit Teil eines sehr vielfältigen und mächtigen Werkzeugkastens an Diskriminierungs-Tools.
Mit diesem Tool fällt es leicht, Unterschiede glatt zu bügeln und gesellschaftspolitische Probleme wegzulächeln: Wenn alle gleich sind, ist doch alles gut, oder nicht? Wenn wir nur die gute Energie der Einheit zwischen uns klingen lassen sollen, wird sich schon alles zum Positiven wenden. Man ahnt es: Toxic Positivity ist eine sehr privilegierte Angelegenheit – von kontraproduktiv ganz zu schweigen. Denn: Viele gesellschaftspolitische Änderungen und Fortschritte in Richtung mehr Gerechtigkeit (Gleichheit ist in dem Zusammenhang auch eine mindestens zu diskutierende Prämisse) wurden nicht dadurch bewirkt, dass Menschen sich lieb hatten und sich stets gefällig (also nach den Regeln der privilegierteren/ machtbesitzenden Gruppe) verhalten haben – sondern im Gegenteil durch aus der Perspektive der Toxic Positivity negativ konnotierten Emotionen, insbesondere Wut.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Genauso wie es an Cis-Männern ist, die Wut von Frauen* und LGBTQIA+-Menschen auf das binäre patriarchale System anzuerkennen und nicht zu pathologisieren oder anderweitig kleinzureden, ist es an weißen Menschen, wütende BIPoC ernst zu nehmen – und darauf zu verzichten, nach einem „netteren Umgangston“ zugunsten der allgemeinen „Harmonie“ zu fragen, wenn gesellschaftspolitische Ungerechtigkeiten adressiert werden. Denn diese Wut fällt nicht vom Himmel: Wenn Gruppen über Jahrhunderte systematisch diskriminiert und ausgebeutet werden und Mitglieder dieser Gruppe sehen müssen, dass das legitimierende System auch im Jahr 2020 immer noch omnipräsent ist und ständig bestätigt wird, können sie gar nicht anders, als irgendwann wütend zu werden.
Denn genau dieses Kleinreden, das als reflexhafter Schutzmechanismus der White Fragility greift, sobald BIPoC es wagen, bestehende systemische Probleme anzusprechen, dient dazu, das aktuelle System zu erhalten. Dann ist es am Ende unbedeutend, wie antirassistisch man sich selbst begreift oder labelt und auf wie vielen Black-Lives-Matter-Demos man unterwegs war – wenn ich durch gleichmachende, silencende und „beschwichtigende“ Floskeln versuche, die Aufmerksamkeit weg vom eigentlichen Inhalt des Problems auf den Ton der Äußerung zu lenken, erhalte ich das rassistische System mit genau dieser Handlung am Leben und verstärke es sogar noch. Handle also: rassistisch.
Wie macht man es also richtig?
„An ally is someone from a non-marginalized group who uses their privilege to advocate for a marginalized group. They transfer the benefits of their privilege to those who lack it.” – Holiday Phillips
An dieser Stelle ist der kurze Einschub wichtig, dass weiße Menschen nicht den Fehler machen dürfen, zu denken, alle von Diskriminierung betroffenen Personen sind in jedem Themengebiet einer Meinung: Natürlich gibt es unterschiedliche Perspektiven auf ein- und denselben Sachverhalt und kontroverse Diskussionen im Safe Space der eigenen Communities. Und anzunehmen, es handle sich bei diesen vielfältigen Meinungen und Personen um eine homogene Gruppe, wäre auch wieder vereinfachend und stereotypisierend (also: rassistisch).
Dennoch ist die Schnittmenge der Forderungen und Ansichten bei Weitem groß genug, als dass man als Weiße*r in Zeiten des Internets und Social Media ungezählte kostenlose (!) Informationsquellen zur Verfügung gestellt bekommt, die einem sehr detailliert erklären, welche Verhaltensweisen rassistisch sind, warum das so ist, wie man es besser machen und vielleicht sogar ein Ally werden kann. (Und nicht der nächst bekannten Schwarzen Person in die DMs auf Insta sliden muss, um nach Erklärungen zu fragen und wieder emotionale Arbeit zu verursachen.)
„I’m not interested in that. I’m not looking to tell people what to do. People are very willing to give up their agency and look for leadership when they feel impassioned about something and I don’t want that at all, I want them to use their critical thinking skills to challenge racism and I can’t tell them how to do that. Imagine you had a partner who you were hoping might be able to improve their perspective on something, and instead they say, ‘just tell me what to do’. That tells me that person isn’t willing to take on any level of responsibility and I guess what I’m trying to do is prompting people to take responsibility for racism. That takes initiative and using your own brain.“ – Reni Eddo-Lodge
Die erste und wichtigste Aufgabe lautet daher: selbstständig zuhören, lesen, sich weiterbilden, die bereits zur Verfügung stehenden Inhalte nutzen und lernen.
Um das erfolgreich umzusetzen, sind 4 Erkenntnisse notwendig:
- Es geht nicht um Schuld, sondern um Verantwortung. Du musst nicht die ganze Schuld deiner Vorfahren auf deinen Schultern umhertragen und dich in Trauer und Schande wälzen. Das bringt niemanden weiter – unter anderem, weil du dich und deine Gefühle wieder in den Mittelpunkt stellst und dich nicht auf diejenigen von Schwarzen Menschen konzentrierst. Du lebst jetzt und dein Job ist, alles in deiner Macht zur Verfügung Stehende zu tun, um das aktuelle System besser zu hinterlassen als du es vorgefunden hast. Dazu ist es jedoch unerlässlich, sich mit der historischen Vergangenheit zu beschäftigen, um zu verstehen, wie das System Rassismus, das wir heute haben, als solches überhaupt zustande kommen konnte und was seine Geschichte vor allem für Schwarze Menschen bedeutet.
- Nochmal ganz explizit: Es geht nicht um dich. Nicht um deine Trauer, deine Überraschung, deinen Schock oder dein Entsetzen angesicht „dieses großen Unrechts!“. Am Ende zeigen diese Emotionen, die du für empathisch und anteilnehmend hältst, vor allem, dass du dich noch nicht umfassend mit deinen Privilegien und deinem Weiß-Sein im System der White Supremacy auseinandergesetzt hast.
„You might also wonder, how can I fix it if I am doing that? One free answer, shut up. Say not one damn word. When black people are speaking of their anger, their pain, their sorrow at seeing another person as a hashtag? Keep your apology. Keep your words of sorrow, we’re busy right now dealing with our own shit & we can’t manage your guilty feelings too.“ – Tanya DePass
- Es ist nicht an dir, Gefühle und Widerstandsformen von Schwarzen Menschen zu bewerten. Schwarze und BIPoC müssen dir nicht zum 405583. Mal freundlich und in angenehmen Tonfall erklären, warum dein Verhalten gerade rassistisch war. (Genau genommen müssen sie überhaupt nichts. Google it.)
- Das ist keine Checkliste, die man abarbeitet und mit der man irgendwann „fertig“ ist. Sondern lebenslanges Lernen. Als weiße Menschen müssen wir anerkennen, dass die Dekonstruktion des seit 400 Jahren herrschenden rassistischen Systems zu unseren Lebzeiten sicherlich nicht abgeschlossen sein wird und wir niemals alles darüber wissen werden – aus dem einfachen Grund, dass wir weiß sind und es ein Berg an Arbeit ist, so ein lang gewachsenes institutionelles, strukturelles und individuelles Problem zu lösen.
Der erste wichtige Schritt ist also eine Selbstreflexion sowie ein Neujustieren der eigenen Position: weg vom Zentrum an den (unterstützenden) Rand, und damit lange überfälliges Platz machen für Menschen, denen jahrhundertelang keine wertschätzende Aufmerksamkeit zuteil wurde.
Lesen, lesen, lesen und zuhören
Das funktioniert sehr gut über die bereits erwähnten Informationsquellen im Internet, doch es ist – gerade, wenn es darum geht, komplexe systemische Zusammenhänge zu verstehen oder die Perspektive empathisch zu wechseln – eine gute Idee, sich einen Grundstock an anti-rassistischer Literatur zuzulegen (diesmal: wirklich zulegen und nicht ausleihen – denn in die meisten Bücher wird man immer wieder reinschauen müssen).
Im Folgenden eine (sehr begrenzte) Auswahl:
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Und der wichtige Hinweis (der nicht nur im Bereich des Bücherkonsums gilt): Antirassistische Weiterbildung ist gut und wichtig. Dennoch sollten weiße Menschen nicht den Fehler machen, Schwarze Menschen lediglich mit (als negativ gelesenen) Emotionen wie Wut, Trauer, Trauma und Leid in Verbindung zu bringen und ihre Lebensrealitäten auf den Schmerz unter der weißen Vorherrschaft zu reduzieren. Will sagen: Es gibt Schwarze Literatur, Kunst, Produkte, Unternehmen, die nicht um die Aufarbeitung der Schwarzen Diaspora und/oder antirassistische Weiterbildung kreisen und damit nicht vordergründig “Dienstleistung” für weiße Menschen sind. Sondern ihre Existenzberechtigung und ihren Wert unabhängig davon generieren.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Es ist sinnvoll und notwendig, über das Lesen und Verstehen komplexer Zusammenhänge und geschichtlicher Daten hinaus Informationen und Einblicke in die Lebensrealitäten Schwarzer Menschen zu erhalten – und den eigenen Feed in sozialen Netzwerken zu diversifizieren. Auch wieder: Nicht mit dem Anspruch im Hinterkopf, jede Schwarze Person, der wir folgen, muss für uns kostenlose antirassistische Weiterbildungsarbeit leisten.
„Ignorance by very definition is a lack of knowledge, so the only way to break down ignorance and your ignorance and the ignorance of others is through education. It’s really important to learn the history of the struggle you’re putting yourself into, to learn about the systems of oppression that exist and how you’re complicit in them, and then, again, remember that it’s not our job to educate you. It’s not hard to educate yourself. You can literally google it.“ – Ben O’Keefe, Aktivist
Im Gegenteil: Es gibt (natürlich) zahlreiche Expert*innen für unterschiedliche Fachgebiete, die mit Sicherheit auch die eigenen Interessengebiete abdecken.
Hier sind ein paar von ihnen:
- @tupoka.o
- @rosa_mag
- @aminajmina
- @ogorchukwuu
- @phoenomenal_com
- @ciani_sophia
- @natasha.a.kelly
- @josephine.apraku
- @joannakyu
- @ajabarber
- @isa_konga
- @ffabae
- @elizabeth.okunrobo
- @black_is_excellence
- @moremaureen
- @aminatabelli
- @hihadnet
- @tesfu_tarik
- @hadi_ja
- @ihartericka
- @_stormae
- @mkoby_
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Das Schauen und Zuhören sollte im Idealfall nicht nur passiv, sondern gleichzeitig in aktiv weitergeführter Selbstreflexion geschehen: Die Einsicht, dass das aktuelle System ein Problem ist und wir als weiße Personen dieses System repräsentieren und von ihm profitieren, wird nicht ausreichen, um die eigenen internalisierten Rassismen herauszufordern und zu überwinden. Dafür müssen wir schon ein wenig tiefer graben.
Dazu gehört auch das Nachdenken über Fragen wie diese:
- Was habe ich bisher an BIPoC und Schwarzen Menschen nicht gesehen – und warum nicht?
- Welche Vorurteile habe ich über BIPoC und insbesondere über Schwarze Menschen – und woher kommen sie?
- Wann habe ich selbst das System Rassismus unterstützt – und was kann ich tun, damit das nicht noch einmal passiert?
- Habe ich mir schon einmal Gedanken darüber gemacht, dass ich weiß bin? Wann war das erste Mal?
- Habe ich (früher oder jetzt) mal gedacht, dass „ich keine Farben sehe“? Denke ich immer noch so?
- Wie hat mein Weiß-Sein meinen persönlichen Lebensweg beeinflusst?
Über wichtige Fragen wie diese können wir aktuell in der 30-tägigen Instagram-Challenge, die die Journalistin Josephine Apraku ins Leben gerufen hat, nachdenken.
Und dann parallel zum Lernen am besten auch sofort zur Tat schreiten.
„Simply ‘saying stuff’ is easy. You know what’s hard? Not buying stuff you want because the supply chain is violent. Turning down a job because the company employs child labor in Africa. Calling out other white people when they say something clearly racist. That shit is hard. But if you want to be a true ally to BIPOC, you have to be willing to do it. Anyone can post hashtags on social media. And the fact that this is seen as an act of activism is deadly.“ – Holiday Phillips
Unbequeme*r Gesprächspartner*in werden und bleiben
Die wichtigste Tat nach dem Selbst-Informieren ist das Informieren anderer weißer Menschen: Das Aufklären am Abendbrottisch, das Unterbrechen in der Gruppe von Freund*innen, wenn jemand einen rassistischen Witz gemacht hat, das Ansprechen eines*r Mitarbeitenden auf eine rassistische Aussage oder anderweitige Handlung.
Das führt häufig zu unangenehmen Situationen, die wir lieber vermeiden möchten – vor allem, wenn es um Menschen geht, die uns nahestehen. Doch wenn wir effektiv an den Fundamenten der White Supremacy rütteln wollen, führt kein Weg an solchen Konfrontationen vorbei. Das ist der Mindestanteil der Arbeit, die wir in unserer Position als Weiße leisten müssen.
Eine Gegenstimme zu bilden und nicht verlegen beim rassistischen Witz mitzulachen, weil man die Stimmung nicht zerstören möchte, durchbricht den Kreis der Weißen Solidarität und lenkt den Fokus auf die Diskriminierung, die in dem Moment geschieht – und damit endlich auf die Menschen, gegen die diese Diskriminierung gerichtet ist.
Diversität einfordern und einbringen
Zu diesen unbequemen Gesprächen gehört auch das aktive Einfordern von Diversität – im Job (wobei hier geraten ist, sicherzustellen, dass sich die weißen Angestellten mit ihrem Weiß-Sein kritisch auseinandergesetzt haben, um eine möglichst rassismuskritische Umgebung zu ermöglichen und Tokenism zu verhindern), in Magazinen, in den sozialen Netzwerken, im Marketing, im Fernsehen: überall.
Das kann das direkte Ansprechen des*der Chef*in auf die mangelnde Diversität im Unternehmen sein*, das Einwerfen in der nächsten Teamsitzung, das Mail-Schreiben an eine Agentur mit der Frage, warum für das Produkt nur weiße Models werben, das öffentliche Auffordern von Unternehmen, ihre Personalpolitik zu überdenken… Wege gibt es genug. Auch aufgrund unterschiedlichen sozialen und finanziellen Kapitals und den sich daraus ableitenden Zwängen stehen auch weißen Menschen unterschiedlich viele davon offen – nichts zu tun, ist allerdings keiner.
*Besonders bezogen auf den Arbeitskontext reicht es nicht aus, sich Diversität auf die Fahnen zu schreiben und dann die Hände in den Schoß zu legen und zu warten, ob und wann und wie viele BIPoC dem Ruf wohl folgen und sich vielleicht-eventuell bewerben wollen. Denn, surprise: Viele Schwarze Menschen und PoC haben gar keine Lust auf den rassistischen Spießrutenlauf, der sie aller Wahrscheinlichkeit nach erwartet, wenn das Teamboard auf der Firmenhomepage rein weiß ist. Der Umkehrschluss: Es ist an Weißen, aktiv auf die Suche nach potenziellen Bewerber*innen zu gehen – Schwarze Expert*innen gibt es in jedem Fachbereich. Wenn man niemanden findet, hat man aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gut genug gesucht.
Umverteilung von Ressourcen: Open your Purse (if you can)
Das Posten der monochromen Kacheln am #blackouttuesday wurde von Schwarzen Aktivist*innen häufig mit der Forderung „Open your purse“ kommentiert – vor allem in den Kommentarspalten großer Firmen, die sich in der Vergangenheit nicht durch Förderung, Einstellung und diskriminierungsfreie Behandlung Schwarzer Beschäftigter ausgezeichnet haben oder bei denen klar ist, dass sie ihre Gewinne auf dem Rücken von BIPoC-Arbeiter*innen aus dem globalen Süden verdienen.
Die Forderung, die durch den Medienschaffenden Adam Martinez auf TikTok viral gegangen ist, setzt direkt an einem der wichtigsten Hebel des rassistischen Systems an: Um die weiße Vorherrschaft (White Supremacy) zu überwinden, müssen Ressourcen umverteilt werden – vor allem auch finanzielle.
Organisationen, NGOs, Vereine und Stiftungen von Schwarzen und/oder für Schwarze benötigen so gut wie immer Spenden – und wann habe ich als Weiße eigentlich das letzte Mal bewusst in einem von Schwarzen Menschen geführten Unternehmen eingekauft?
Dass Geldflüsse politische Auswirkungen haben, haben wir im Rahmen von Biolebensmitteln, Fair Fashion und Veganismus mittlerweile ausreichend diskutiert – doch dass die gezielte finanzielle Unterstützung von BIPoC ebenfalls nicht nur möglich und wichtig, sondern notwendig ist, wurde vielen Weißen erst im Laufe der vergangenen Wochen klar.
Schwarze Vereine und Organisationen, die ihr unterstützen könnt:
Für wen es (aktuell) nicht möglich ist, zu spenden, kann auf YouTube nach Donate-Videos für #BLM suchen und im Hintergrund laufen lassen (die Werbung nicht überspringen): Die Einnahmen, die durch das Ausspielen der Anzeigen generiert werden, werden an Schwarze Organisationen und Vereine gespendet. (Die ursprüngliche Idee stammt von der YouTuberin Zoe Amira, allerdings ist ihr Video mittlerweile nicht mehr online und es ist natürlich nicht 100%ig abgesichert, dass die Einnahmen wirklich dort ankommen, wo sie sollen.)
“You know what does have mass influence? Systemic white apathy and privilege. And I’m sorry to say, if you’re white, no matter how nice you are, unless you’re doing serious and sustained personal anti-racism work, you are a part of the machine.“ – Holiday Phillips
Neben der gezielten Umverteilung finanzieller Ressourcen von den Konten weißer auf die Schwarzer Menschen ist selbstredend auch der bewusste Verzicht von Produkten und Dienstleistungen von Firmen, die nachweislich BIPoC (hier und im globalen Süden) ausbeuten und nur deswegen in ihrer heutigen Form existieren können, essenziell. (Das Argument, diese Beschäftigten hätten sonst aber gar keine Jobs, darf übrigens unausgesprochen wieder in den Tiefen der Gedankengänge verschwinden.)
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Wir werden Fehler machen: Wie man sich entschuldigt
Die harte Wahrheit: Auch, wenn wir uns noch so intensiv mit Rassismus beschäftigen, uns weiterbilden, Gespräche aus unterschiedlichen Positionen führen und dementsprechend viele Informationen haben – als weiße Menschen werden wir (ich wiederhole mich) niemals alles über Rassismus wissen.
Das bedeutet, dass wir zwangsläufig Fehler machen – und dass sie gesehen und angesprochen werden.
Ich gehe jede Wette ein, dass ich in diesem Artikel allein mindestens zwei Fehler gemacht habe und bin dankbar, wenn mich jemand darauf hinweist.
Entscheidend ist, wie wir mit diesen Hinweisen auf Fehler (und damit: rassistisches Verhalten und dahinterliegende rassistische Einstellungen) umgehen. Es ist leicht, Verantwortung von sich zu weisen und die klassischen Register der White Fragility zu ziehen: Glauben, man wurde gerade als böser Mensch bezeichnet, leugnen, emotional werden, zum Gegenangriff übergehen. Und damit die gesamte Verantwortung und emotionale Arbeit auf das Gegenüber abzuladen und das bestehende System zu bestärken (s. Tabelle oben).
Weil genau das so oft passiert (nicht nur bei Menschen, die sich noch nicht mit ihren inhärenten Rassismen auseinandergesetzt haben), ist das Ansprechen von rassistischen Äußerungen und Handlungen für BIPoC immer auch ein riskanter Akt. Genau aus dem Grund ist es unter anderem so wichtig, die ganze Arbeit nicht nur bei BIPoC zu belassen, sondern sich als Weiße gegenseitig in die Verantwortung zu nehmen.
Wenn ich einen Fehler gemacht habe und darauf hingewiesen werde, ist es empfehlenswert, sich an folgendes Handlungsschema zu halten:
- Den Fehler anerkennen / zugeben: „Es tut mir leid, dass ich XXX getan habe und mich damit rassistisch dir gegenüber / der Gruppe XXX verhalten habe.“
- Erklärungen mit „aber“ oder „falls“ vermeiden: „…aber so habe ich das gar nicht gemeint.“ / „…falls das bei dir so rübergekommen ist.“ Ist geht nicht um deine Intention, sondern um die Wirkung der Handlung.
- Sich bedanken: „Danke, dass du mich auf diesen Fehler hingewiesen hast.“
- Das Verhalten nachhaltig ändern. (Sonst ist die Entschuldigung wertlos.)
Diese Reise wird niemals zu Ende sein
„[B]eing an antiracist is an action, it’s a verb. It’s not something that you just learn and you stop, it’s about how you change your behavior every day, every week, every month, every year to move your community, your family, yourself toward a more just and equitable society.” – Leslie Mac, Aktivistin
Die wahrscheinlich wichtigste Einsicht, die weiße Menschen sowohl im Umgang mit dem eigenen internalisierten Rassismus als auch mit Blick auf das System der White Supremacy gewinnen können (und es wäre ideal, wenn sie ziemlich weit am Beginn der Reise stehen würde): Rassismus schaffen wir nicht mit ein paar Posts auf Social Media und dem Besuch einer Demo ab. Weder in den Institutionen noch in den Köpfen der Menschen und schon gar nicht in unserem eigenen Kopf – egal, wie viele BIPoC-Freund*innen wir haben, egal, ob wir uns jahrzehntelang mit antirassistischer Arbeit beschäftigen und vollkommen egal, wie sehr wir glauben, die Materie durchdrungen zu haben.
„Performative allyship however is a behavior pattern we must learn to recognize in ourselves and others as part of our ongoing antiracist work. This work is often uncomfortable because of the looming dread of “not doing enough,” coupled with the potential shame of doing the wrong thing in public and receiving criticism. We are collectively past that point. Your personal insecurity should not override human suffering. No act will ever be enough. One act of kindness will not undo five centuries of wrongdoing. Nor should any criticism of your social faux pas or misguided post on social media discourage you from your commitment to antiracist work either. We need to not make this about ourselves.“ – Marco Gomez
Diese Arbeit ist eine, die ein Leben dauert. Unseres mindestens, höchstwahrscheinlich und leider auch das unserer Kinder und Enkelkinder – immerhin haben wir über 400 Jahre aufzuarbeiten. Und auch, wenn sich der aktuelle Diskurs anders anfühlt als die vorherigen und man den Eindruck und die Hoffnung hat, der performative Aktivismus der Weißen wird sich diesmal nicht nach wenigen Wochen wieder im Sande verlaufen (wie das bisher relativ vorhersehbar der Fall war): Die Beschäftigung mit Rassismus, die in den vergangenen Wochen begonnen hat, kann nur als Startschuss für eine intellektuelle und emotionale Auseinandersetzung fungieren, die kein Ende haben wird und hinter die man keinen To-Do-Listen-Haken setzen können wird. Eine nicht zu erfüllende Erwartung, die auszuhalten und zu ersetzen sein wird durch das Aktivwerden um der Ungerechtigkeit und nicht um des eigenen Status‘ Willen.
Und das ist am Ende vielleicht der entscheidende Punkt, an dem sich performativer von nachhaltig authentischem Aktivismus trennt.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an


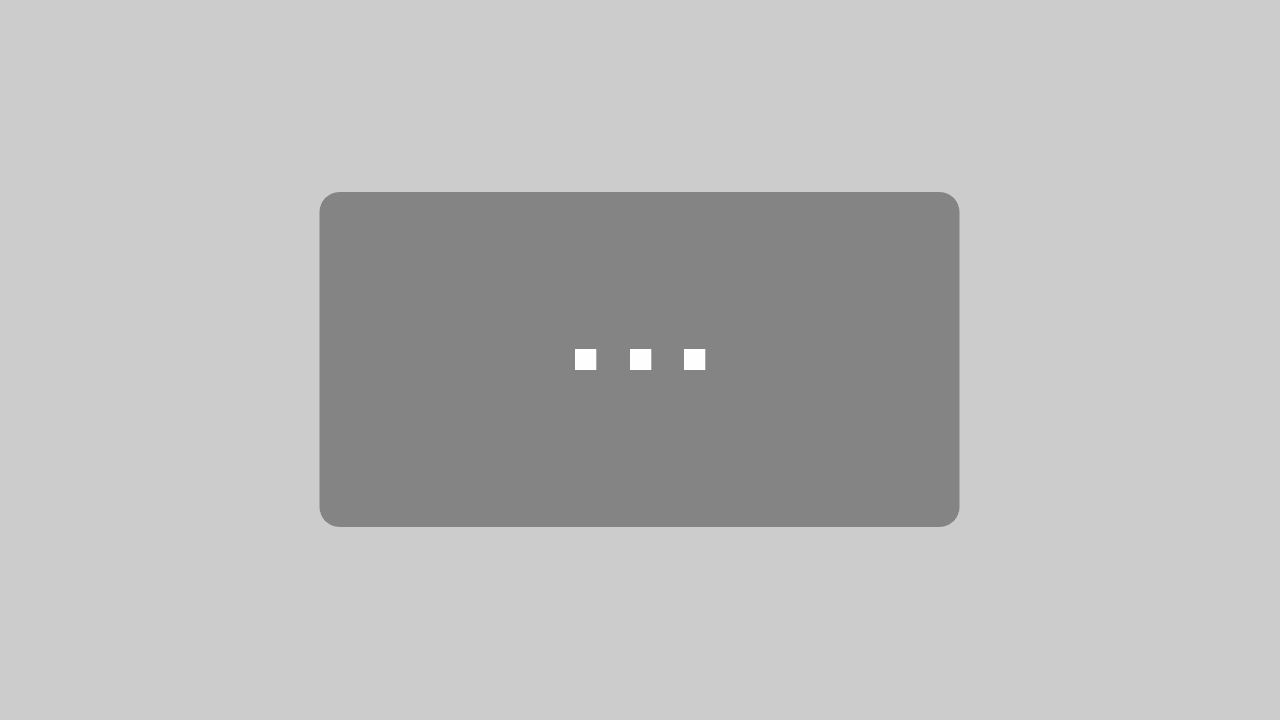
7 Antworten auf „How to be an Ally: Wie weiße Menschen langfristig den Kampf von BIPoC unterstützen können“
Rasismus ist ein wichtiges Thema, keine Frage.
Aber warum muss ich mich als Weißer mensch schlecht fühlen für Dinge, die ich nicht getan habe und für die ich nichts kann?
Es hat fast schon sowas als müsste man sich heute als Weißer Mensch dafür entschuldigen, dass Generationen vor uns Mist gebaut haben.
Das nervt langsam!
Wie in dem Artikel schon gesagt wurde, es ist keine Frage von Schuld, sondern Verantwortung. Als weißer Mensch trägst du die Verantwortung deine täglichen Entscheidungen und Handlungen zu hinterfragen, zu reflektieren und diese zu ändern. Niemand wirft dir vor, dass du als weißer Mensch geboren bist, sondern es wird kritisiert, dass du deine privilegierte Position in der Gesellschaft nicht reflektierst und nicht täglich daran arbeitest den gegebenen Strukturen entgegen zu arbeiten.
Toller Artikel, ich bin froh, DASs ich ihn gefunden habe ich wollte nämlich meine Mutter in das Thema einführen und die kann kein Englisch. Sie hat sich auch angegriffen gefühlt und argumentiert mit “nicht alle Weissen” und “als wären wir alle Böse” aber sie will trotzdem weiter lernen, da bin ich froh drüber. Ich werde mal sehen ob das Buch “exitRacism” was für Sie ist.
Hallo,
danke für diesen wirklich aufschlussreichen Artikel.
Besonders spannend: “Der erste wichtige Schritt ist also eine Selbstreflexion sowie ein Neujustieren der eigenen Position: weg vom Zentrum an den (unterstützenden) Rand, und damit lange überfälliges Platz machen für Menschen, denen jahrhundertelang keine wertschätzende Aufmerksamkeit zuteil wurde. ”
Wie macht Ihr dies bei Fashion Changers?
Den Betroffenen Raum geben statt selber Raum einzunehmen.
Habt Ihr den Eindruck, dass Ihr als Fashion Changers es schafft oder besser darin werdet, den Stimmen von BIPoC Raum zu bieten, statt selber zu sprechen? Gelingt es euch BiPOC Fashion Changers Bühne und Unterstützung zu geben?
Ich reflektiere gerade stark dazu.
Es ist echt nicht einfach. Es hieße doch auch: Statt selber die Veränderung umzusetzen, die einem wichtig erscheint, erst zu schauen, ob es BIPoC gibt, die sich eines solchen Projekts/Thema annehmen und sie zu unterstützen. Also Ihnen die Bühne zu vergrößern, statt eine Bühne für das eigene Projekt aufzumachen.
Und was, wenn man den Eindruck hat, so weniger und langsamer verändern zu können, als wenn man selber in der gewohnten Weise agiert? Dann trotzdem das “wie” wichtiger nehmen, um nicht rassistische Kontinuität fortzuführen? Rauskriegen, wie man mit BIPoC im Fokus/ am Steuer dennoch vom Rand gleichviel Unterstützung für das Thema reingeben kann? Auch wenn diese weiter weg sind? Gerade auch in der Fast Fashion sind die Betroffenen in entfernten Ländern. Sie hatten nicht die Ressourcen und Bildungschancen, um die selben Wirkungschancen zu entwickeln. Das erst nachholen – Ressourcen umverteilen und Bildung ermöglichen – wow ein langer Weg.
Ich merke wirklich, dass ich noch viel zu dem Thema durchdringen muss.
Wie sind eure Erfahrungen bei Fashion Changers?
Das fände ich echt spannend!
[…] Fashionchangers.de: Ein Artikel über Allyship in Bezug auf Schwarze und Indigene Menschen sowie People of Color. […]
… [Trackback]
[…] Read More here: fashionchangers.de/how-to-be-an-ally-wie-weisse-menschen-langfristig-den-kampf-von-bipoc-unterstuetzen-koennen/ […]
… [Trackback]
[…] Informations on that Topic: fashionchangers.de/how-to-be-an-ally-wie-weisse-menschen-langfristig-den-kampf-von-bipoc-unterstuetzen-koennen/ […]